Von Thomas Sünder / Fotos: andyalexander.de
Der Zahnarzt Dr. Thomas Schünemann hat einen validierten Therapieansatz für Tinnitus – ein Interview
Fünfzehn Prozent der Deutschen sind von Tinnitus betroffen. Viele suchen Hilfe in Hörakustikfachgeschäften. Doch einige Hörakustiker schrecken vor dem Thema zurück, da der Behandlungserfolg mit Hörgeräten und Noisern nicht bei allen Betroffenen gegeben ist. Wer käme auf die Idee, dass ein Zahnarzt einen validierten Therapieansatz bietet? Ich spreche mit Dr. Thomas Schünemann aus Marburg.

Herr Dr. Schünemann, wie kommt ein Zahnarzt darauf, sich mit Tinnitus zu beschäftigen?
Ich bin seit 25 Jahren am Thema. Und ich kam zufällig dazu. Damals hatte ich mit meinem kieferchirurgischen Lehrer eine Kopfschmerz-Sprechstunde eingerichtet. Die meisten Hilfesuchenden waren Frauen mittleren Alters. Alle Patienten hatten gemein, dass sie als austherapiert galten und unter starken Schmerzen litten. Es waren 350 wirklich schwere Fälle. Wir haben festgestellt, dass bei ihnen durchweg die Kiefergelenke durch nächtliches Pressen und Knirschen zusammengedrückt waren. Diese klinischen Befunde sind zahnärztlich gut bekannt: Die Kiefermuskeln sind ausgesprochen stark und lassen nachts gut und gerne 150 Kilogramm auf Zähne und Kiefer wirken. Durch nächtlich zu tragende Aufbiss-Schienen, Okklusionsschienen, konnten wir die Kiefergelenke der Patienten wieder dekomprimieren und die Symptomatik in den meisten Fällen beheben.
Was hat das mit Tinnitus zu tun?
Ich hatte in der Anamnese abgefragt, ob auch Ohrprobleme vorlägen, also Tinnitus, Schwindel oder sonstige Hörprobleme. Das traf in 40 Fällen zu. Ich war erstaunt, dass bei vielen als Nebeneffekt der Tinnitus gelindert wurde oder sogar verschwand. Das heißt, bei Patienten mit gestauchten Kiefergelenken hatten wir einen Gleichklang zwischen Erfolg in der Kopfschmerztherapie und Verbesserung beim Tinnitus. Das ist der fachliche Zusammenhang zwischen zahnärztlicher Funktionsdiagnostik und Tinnitus & Co. Das fand ich so beachtlich – und konkret hilfreich – , dass ich das Thema im Praxisalltag systematisch weiterverfolgt habe. 2016 konnte ich den schmerzfreien Griff MTT, den Manuellen Tinnitus-Test, etablieren. Er ist nicht nur meine Intervention bei verspannten und gestauchten Kiefern, sondern sagt in nur einer Sitzung prognostisch, ob Funktionstherapie beim Hilfesuchenden auch eine Verbesserung des Tinnitus wahrscheinlich werden lässt. Seit 2018 lasse ich die Dokumentation meiner Behandlungen durch einen neu eingestellten Mitarbeiter wissenschaftlich auswerten. 2021 wurde die Methode durch Einführung eines 3D-Scans des Kiefers und gefräster Schienen nochmals verbessert. Seit 2024 beziehe ich die Vagusfunktion mittels Pulsmessung ein, und seit 2025 quantifizieren wir auch die psychische Be- und Entlastung meiner Tinnituspatientinnen und -patienten.
Damit wir das richtig einordnen: Allgemein wird davon ausgegangen, dass Tinnitus chronisch ist, wenn er länger als drei Monate besteht. Sie haben mit dieser Methode Betroffenen helfen können, die eigentlich als chronisch galten?
Das ist richtig. Ich erinnere mich an einen Patienten mit einer 39-jährigen Leidensgeschichte. Sein Ton konnte während der Behandlung deutlich gemindert werden.
Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
Ich berücksichtige einen in Vergessenheit geratenen anatomischen Aspekt, dem ich als Student im ersten Semester begegnet bin. Mit wem ich auch spreche: Er wird aktuell nicht bedacht. Es geht um die Verbindung von Kiefer und Mittelohr: Bei der menschlichen Entwicklung wandert das primäre Kiefergelenk des Embryos im dritten Monat hoch ins Mittelohr und bildet die Gehörknöchelchen. Dabei wandelt sich der frühe Unterkieferknorpel, der Meckelknorpel, in ein festes Ligament, das von der Kieferinnenseite nach oben durch die Schädelbasis zieht und das den Kiefer mit dem Mittelohr verbindet. Dieses Band ist vier Millimeter breit und sehr stabil. Es endet direkt an den Gehörknöchelchen, und zwar am vorderen Hammerfortsatz. Das heißt, die unmittelbare Wirkung vom Kiefer auf das Mittelohr ist viel größer als gemeinhin angenommen. In den Anatomiebüchern wird es aber häufig so dargestellt, als würde keine oder nur eine indirekte Verbindung bestehen.
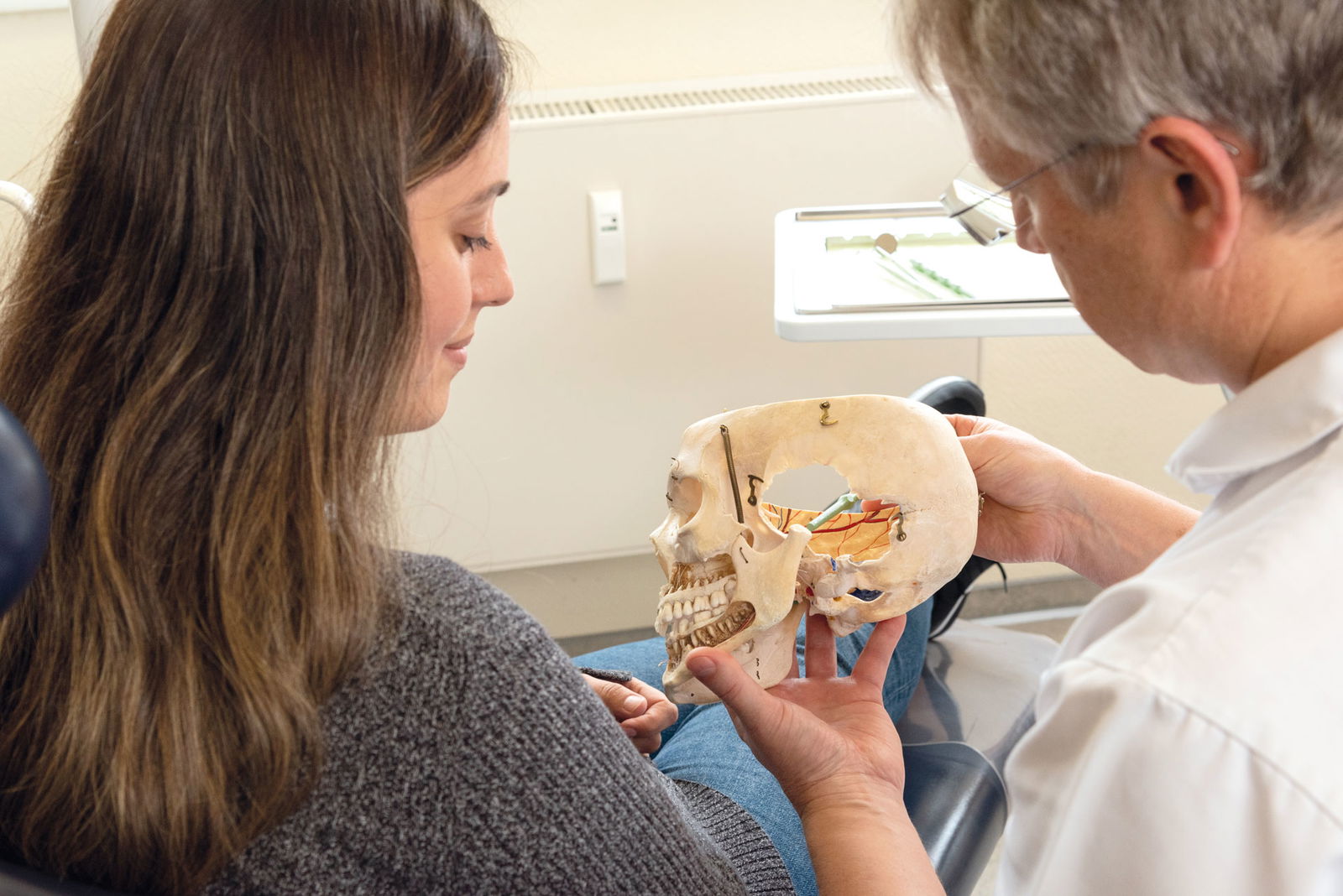
In meiner Ausbildung zum Hörakustikmeister wurde diese direkte Verbindung vom Kiefer zum Mittelohr nicht erwähnt. Wie haben Sie ihre Existenz überprüft?
Ich habe mit einer Doktorandin wiederholt menschliche Schädel präpariert. Wir haben die knöcherne Schädelbasis eröffnet und das Band freigelegt. Bei üblichen Präparationen wird das Band einfach gekappt. Deshalb wird es auch funktional regelmäßig übersehen oder als reines Halteband gewertet. In der Behandlung dekomprimiere ich das Kiefergelenk mit dem MTT, indem ich mit dem Daumen auf die hinteren Zähne drücke und gleichzeitig den Unterkiefer mit der Hand sanft drehe. Dadurch wird einerseits der Kiefer entlastet, gleichzeitig ziehe ich am Band. Das ist der Moment, in dem die Mehrzahl meiner Patientinnen und Patienten eine Linderung spürt. Bei manchen verschwindet der Ton sogar vollständig, wenigstens kurzzeitig. Parallel messen wir den Puls. Dieser geht bei den meisten während des Griffs herunter, manchmal um bis zu 20 Schläge pro Minute. Das liegt daran, dass durch eine minimale Verkippung des Schläfenknochens (os temporale) Hirnhaut und Durchgang des Vagusnervs entlastet werden.
Welche Patientinnen und Patienten kommen zu Ihnen?
Die Betroffenen in meinem Wartezimmer bilden eine völlig heterogene Gruppe, aber die meisten von ihnen gelten anderswo als austherapiert. Ich kann nicht allen vollständig helfen, aber vielen Linderung verschaffen. Ich untersuche Kohorten und verstehe, dass etwa Frauen und jüngere Patienten leicht höhere Heilungschancen haben.
Wie haben diese Entdeckungen Ihren Arbeitsalltag verändert?
Meine zahnärztlichen Patientinnen und Patienten müssen schon mal länger auf einen Termin warten, weil die funktionsdiagnostische Sprechstunde mittlerweile die Hälfte meiner Kraft und Zeit in Anspruch nimmt. Nur mit zeitweiser Vorfahrt für Tinnitus-Termine kann ich stabil 250 zusätzliche Behandlungen pro Jahr integrieren. Regelmäßig biete ich dabei zusätzlich Individuelle Tinnitus-Tage (ITT) an: Patientinnen und Patienten nutzen diese kombinierten, fertig ausgeplanten Therapieaufenthalte vor Ort in Marburg mit drei Übernachtungen, Untersuchung mit MTT, Schiene, Osteopathie und manueller Therapie.

Die ganzheitliche Betrachtung spielt eine wichtige Rolle. Ich untersuche etwa auch die Auswirkungen bei Schwindel. Das Ohr ist eben kein isoliertes Organ. Deshalb braucht es nicht nur mich als Funktionsdiagnostiker. Ich habe regelmäßig Überweisungen von anderen Fachrichtungen einschließlich der Hörakustik und empfehle eine vorherige Abklärung durch die Kollegen der HNO. Ich gebe meinen Patientinnen und Patienten auch Hausaufgaben mit und verschreibe Manuelle Therapie und Osteopathie, denn manchmal kommen Verspannungen des Kiefers durch Fehlstellungen von Wirbelsäule oder Hüfte zustande.
Davon kann ich ein Lied singen. Ich gehe davon aus, dass eine Hüftfehlstellung in letzter Konsequenz über die Wirkung auf den Kiefer meinen Morbus Menière ausgelöst hat. Doch bleiben wir bei Ihnen: Wie bewertet die Wissenschaft Ihre Erfolge?
Eine wissenschaftliche Herangehensweise ist mir sehr wichtig. 2019 hat mein damaliger zahnärztlicher Assistent seine Doktorarbeit über den Zusammenhang zwischen MTT und Veränderung des Tons verfasst. Dafür hat er den Wissenschaftlichen Bestpreis der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie DGFDT gewonnen. Aktuell werten wir unter anderem Zahlen aus, die wir mittels eines wissenschaftlichen Tinnitus-Fragebogens gewinnen und die den Zusammenhang zwischen psychischem Befinden und physiologischer Wirkung von MTT und Schiene beleuchten. Ich wünsche mir einen noch breiteren interdisziplinären Dialog der Expertinnen und Experten für Ohrfunktion und gutes Hören. Vielleicht kann dieser Artikel dazu beitragen, das Thema in der Hörakustikbranche neu aufzugreifen.
Das hoffe ich. Deshalb wird es in der nächsten Ausgabe einen weiteren Artikel zu diesem Thema geben, in dem ich auch meine eigenen Erfahrungen mit Ihrer Methode und der von Ihnen angewendeten Dekompressionsschiene beleuchte. Herr Dr. Schünemann, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.


